Agrarindustrie und Infrastrukturen – Industrielogik oder Landschaftslogik oder beides? Wie vermitteln wir die durch den Klimawandel notwendigen Veränderungen im Antlitz der Landschaft als Chance zu Bereicherung und Gestaltung anstatt als Verlust?

Quelle: nlsolarparkdekwekerij.nl, info@nlsolarparkdekwekerij.nl
Die landwirtschaftliche Produktion bringt Produkte hervor; die Landschaft dagegen ist ein Werk. [Lefebvre, Recht auf Stadt. Hamburg 2016 (i. O. Paris 1968), S. 106]
Manifestieren wir nicht nur Stadt, sondern auch Landschaft als soziale Form! Um Landschaft weder als Natur noch als Bild, sondern als soziales Werk zu verstehen, müssen wir opportunistische Logiken von Landnutzungen, Infrastrukturen, aber auch des Naturschutzes in einer neuen multifunktionalen Landschaftskultur aufheben.
Landschaft als soziale Form, als kulturelles Werk? Das lässt sich, wie Baukultur, nicht einfach verordnen. Landschaft ist nur sehr eingeschränkt das Territorium der Landesplanung oder Landschaftsarchitektur, vielmehr das einer Landeskultur [W. Haber, Die Kultur der Landschaft], deren Bewirtschaftungen und Verbesserungen allein auf Effizienz und Produktivität – und jenes der Infrastrukturen, deren Trassen und Anlagen allein auf die Überwindung von Raum und Zeit ausgelegt sind. Dieses Problem der Dominanz opportunistischer Systemlogiken kennt auch der Städtebau, der mindestens seit 1850 von Nicht-Architekten, nämlich Ingenieur-Stadtplanern beherrscht wird.
Dass Land nicht in erster Linie ‚gebaut‘, sondern ‚angebaut‘ und ‚übernetzt‘ wird, und trotzdem ein soziales Werk schafft, ist in der Architekturtheorie eigentlich bekannt, da Bauen sowohl das Errichten und Herstellen – aedificare – wie auch das Hegen und Pflegen des Wachstums – cultura – umfassen soll. [M. Heidegger, Bauen Wohnen Denken] In der Praxis ist dies aber doch schwer zu vermitteln. Wer fordert, Stadt nach architektonischen Regeln zu bauen, wird zwar als Idealist bezeichnet werden, aber doch noch auf Verständnis stoßen – wer fordert, das Land nach Regeln der Landschaftsarchitektur zu bewirtschaften, bislang eher nicht.
Es besteht Anlass, das zu ändern. So wie spätestens seit Anfang der 1980er Jahre auch in Deutschland, die geschichtsvergessene Stadtzerstörung als das vordringliche Problem der Lebenswelt des Menschen erkannt wurde, so sind es heute die Vereinheitlichungen der Landschaft durch industrielle Landwirtschaft, die Zersiedlung durch Einfamilienhaus-, Industrie- und Logistikkomplexe und durch ‚Überland‘-Infrastrukturen wie Fernstraßen und Hochspannungsleitungen. Wir sehen nun: der radikalste und rücksichtsloseste Wandel betrifft das Land [R. Koolhaas, Manifesto on the countryside] und hier entscheidet sich wesentlich die Zukunft der Erde, auch wenn diese vollständig urbanisiert sein wird.
Dieser arbeitsteiligen Zerstörung des Landes eine zusammenführende Logik der Landschaft entgegenzusetzen, kann nur als soziales Projekt entstehen. Überzeugende Manifeste hierfür gibt es: die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in der Verfassung, das europäische Landschaftsübereinkommen, Gutachten für einen Gesellschaftsvertrag der Transformation und eine Landwende im Anthropozän.
Es gibt aber auch überzeugende Praxis – durchaus in allen Maßstäben. Eine soziale Form der genutzten Landschaft entsteht in den National Tourist Routes in Norwegen, in denen die Erschließung von Peripherien als Fest des Weges gefeiert wird. Oder in der Solar-Freiflächenanlage De Kwekerij in den Niederlanden, die Biotop und Nachbarschaftspark zugleich ist. Sie entsteht in den Konturfeldern Doug Tompkins in der patagonischen Laguna Blanca, die der Landschaft folgen und sie zugleich mit Strukturen anreichern. Sie entsteht in den Fluren der Herrmannsdorfer Landwerkstätten, wo Feste und Kunst Schwein haben. Sie wächst in den Wiedervernässungen im schwäbischen Donaumoos und in der Klimakulturlandschaft Kannawurf.

Quelle: nlsolarparkdekwekerij.nl, info@nlsolarparkdekwekerij.nl
Es ist ein wichtiger Schritt, diese Beispiele nicht als ‚architektouristische‘ Highlights zu nehmen und die Schönheit dieser Orte als möglichst menschenleere Bilder vor Augen zu haben. Auf den norwegischen Landschaftsstraßen fahren Autos, im Solarpark bellen Hunde, in den bunten Feldern arbeiten Menschen und schlachten in den Werkstätten, an den Moorhufen leben Menschen, deren Großeltern das Land urbar gemacht haben, das restaurierte Renaissanceschloss grenzt an den Nachfolgebetrieb einer LPG.
Wir müssen begreifen, dass die Form der Landschaft in diesem Sinne eine soziale Form ist, und dass ihre Transformation nur gelingt, wenn die bestehenden Milieus geschützt und zugleich Pionierinnen neue räumliche Szenen besetzen können. Ein soziales Projekt Landschaft muss von oben wie von unten befördert werden: durch eine staatliche Gemeinschaftsaufgabe, in der die Garantie gleichwertiger Lebensverhältnisse eingelöst wird. Und durch eine Recht-auf-Landschaft Bewegung, in der das Land dort instandbesetzt wird, wo Spekulation, Anbauwirtschafts-Funktionalismus und politische Vernachlässigung leere Orte hinterlassen haben.
Der erste, einen gesellschaftlichen Diskurs über eine soziale Landschaftskultur auslösende Schritt liegt im überfälligen Beitritt Deutschlands zur Europäischen Landschaftskonvention.
[Beitrag von Sören Schöbel-Rutschmann, LG Bayern]
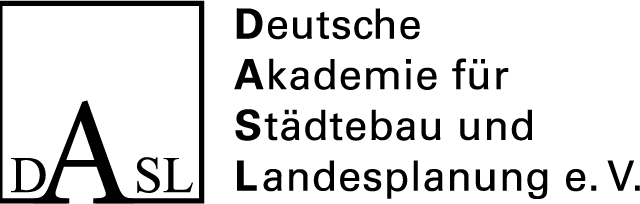
Pingback: Landesgruppe Bayern – Quartiere machen