Die Unordnung zulassen. Wie produzieren wir Vertrauen trotz Unsicherheit? Wie schaffen wir Aufbruchstimmung? Wen wollen wir ansprechen?
Schönheit und Verzicht sind Begriffe von Gewicht, die es uns nicht leicht machen. Durch unsere Planungspraxis entstehen räumliche Projekte, die es erzielen Orte zu schaffen oder zu verbessern. Sei es offenen Bedarfen nachzukommen oder räumliche Organisation anzupassen. Die Schönheit des Endergebnisses ist nur subjektiv bewertbar, aber sehr wünschenswert, da mit ihr Akzeptanz erhofft und allgemeine Zufriedenheit erwartet wird. Entscheidend ist, dass das Projekt dann auch „endlich fertig“ wird. Schön – mit klarer Linie, soll es werden und fertig – nach Zeitplan und im Rahmen der Kosten. Aus welchem Grund Projekte überhaupt gemacht werden, möchte immer wieder neu reflektiert werden. Sehr schön ist es, wenn „das gute Leben für alle“ als gemeinsames Ziel visiert wird.

Vor dem Hintergrund unserer ökologischen Krise und Rohstoffknappheiten wird zu Verzicht und Maßhalten aufgerufen. Nach Jahrzehnten des Überflusses und der Grenzenlosigkeit des Konsums, im Privaten wie im Bauwesen, erscheint derzeit „Verzicht“ als diktatorische Einschränkung. Aber: Wer kann überhaupt frei entscheiden zu verzichten? Ist Verzicht ein neuer Luxus? Fest steht: Wir haben viele offene Bedarfe, z.B. den des leistbaren Wohnraums und der sozialen Treffpunkte, und wir müssen den Umgang mit unseren Ressourcen deutlich schonender halten. Die Komplexität dieser Aufgaben ist überwältigend, klare Pläne für ein „fertig werden“ um Grundbedürfnissen gerecht zu werden, ließen sich bisher nicht umsetzen. (Dass etwas „makellos schön und vollkommen“ wird, bleibt eher leiserer Anspruch und wird im Rahmen des Möglichen verfolgt).
Nun scheint es in den eingefahrenen Strukturen und Mechanismen des Bauens bisher nicht möglich, nur noch solche Planungen vorzunehmen und umzusetzen, die unserem Wissensstand entsprechen und sozialer und ökologischer Gerechtigkeit nachkommen. Es fehlen die Spielräume zum anders machen und es mangelt an Erfahrungen im Sinne der Bauwende um diese zu skalieren. Wo sind z.B. die Spielräume in München? Zu „fertig“ und zu „schön“, schon immer zu lückenlos. Aber viele soziale Bedarfe können in diesem Konstrukt nicht erfüllt werden. Als Initiative haben wir uns die Frage gestellt, wie wir zur Beschleunigung der Bauwende, u.a. in München beitragen können, um uns der Trägheit zu widersetzen darauf zu warten, bis die gesetzlichen Vorschriften und Sanktionen ein „weiterso“ nicht mehr zulassen. Wie kommen wir in Schwung? Und welche Nebeneffekte, könnte dieser Schwung mit sich ziehen? Wie z.B. durch Erfahrungen, dass Verzicht nicht rein als Einschränkung zu sehen ist.

Ohne einen fertigen Plan und ohne ein klares schönes Bild vor Augen, haben wir uns als „Initiative JustizzentrumErhalten“ vorgenommen, einen offenen Prozess um die Zukunft des Strafjustizzentrums an der Nymphenburger Straße anzuregen. Um Gehör zu bekommen, konnten wir viele Unterstützende aus der Fachwelt sowie eine Horde Eisbären zu unserem Rücken machen. Unsere Forderung besteht darin, die wahnsinnige Gebäudesubstanz zu erhalten und beispielhaft als Potential zu betrachten. Aufmerksamkeit gibt es nun schon, die Wirksamkeit der Initiative wird weiter forciert. Denn, im Nachdenken über die Rolle des Gebäudebestands in München lassen sich Ansätze finden, die in der Münchner Stadtbevölkerung zu einer neuen Visionskraft führen könnten.
Der Gebäudebestand wird derzeit zur Last für seine Bestandshalter:innen und Immobilienunternehmen. Alternde Substanzen, Sanierungsstau und Leerstand nach Nutzungsverlust: Zeigt nicht genau dieser unperfekte Bestand die uns fehlenden Spielräume auf? So könnte das Zugänglich machen dieser Spielräume für jene offenen Bedarfe dazu führen, dass wir an deren Nutzbarmachung kollektiv lernen. Planende und Nutzende erproben neu, mit den eingeschränkten Mitteln unserer bestehenden Räume zuarbeiten und Leistungsgrenzen zu erkennen. Die gezielte Beteiligung der Nutzenden an den damit einhergehenden Prozessen, bedeutet ein Lernen im Rahmen des Möglichen. Es stellt sich nicht die Frage des Verzichts für die Inwertsetzung des Bestandes, sondern die Frage nach der Notwendigkeit, dem „so viel wie nötig“.
Damit einher geht auch die Rolle der Ästhetik und der Gestaltung – im offenen Prozess, der auch das Aushalten von Unordnung einfordert, kann es zur Aufgabe von Gestaltung werden, an der richtigen Stelle Rahmen zu setzen. So wird die Gestaltung nicht zur alles durchsetzenden Kontrollinstanz, aber zum Mittel, um in der geteilten Verantwortung für das gemeinsame Projekt die Schönheit im „neuen Alten“ herauszuarbeiten. Die Schönheit liegt dann im Verzicht auf ein tabularasa und in der Wertschätzung der Substanz, und zwar durch viele verschiedene Augen betrachtet.

[Beitrag von Leila Unland, Kollektiv P.O.N.R., Initiative JustizzentrumErhalten LG Bayern]
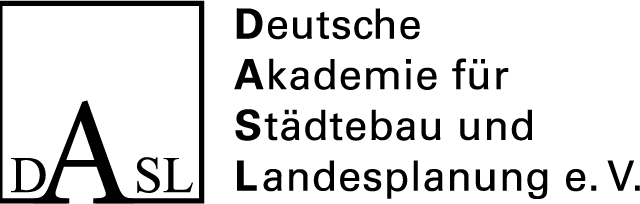
Pingback: Wie wenig ist genug? – Quartiere machen