(Wie) kann man ökonomische Logiken dazu bringen, nachhaltig Schönheit zu produzieren?

Quelle: Robert Neuberger
1
«Erst das Fressen, dann die Moral»
«Schönheit ist ein Luxus, den wir uns nur in guten Zeiten leisten können»
2
Die Zeitenwende ist in Deutschland ausgerufen worden. Die DASL hat 2022 nachgezogen mit der ‘Berliner Erklärung’ zu «Unsere Städte und Regionen: Was sich ändern muss – wie wir uns ändern müssen.» Die Jahrestagung 2023 der DASL ruft zu einer ‘Raumwende’ auf. Zu fragen ist daher: Welche Instrumente bewirken was? Vielleicht also: weniger ist mehr und damit hin zum Weg in eine neue Subsistenz? Könnte die vermaledeite ökonomische Logik am Ende helfen, «Schönheit zu produzieren?» Hier schliesst die Frage an: Kann man ‚Schönheit‘ überhaupt quantitativ fassen oder bleibt dieser ‘letzte Wert’ rein subjektiv? „Beauty is in the eye of the beholder”, sagt man im Englischen.
3
Mit ‘letzten Werten’ befasst sich die Disziplin der Philosophie. Sie behandelt – stark vereinfacht – als Erkenntnistheorie die Frage nach dem ‘Wahren’, also was ist? Was ist das ‘Gute’ – also: was soll? behandelt die Ethik als wissenschaftliches Feld. Die Frage nach dem ‘Schönen’ – also: was gefällt? Gehört zum Feld der Ästhetik. Das eine kommt langfristig ohne das andere nicht aus.
Über das Schöne und die Schönheit gibt es Bibliotheken voll von geistreichen Aussagen. Eine besondere Rolle kommt dem von vielen Menschen weltweit als ebenmäßig oder ‚schön‘ empfundenen ‚Goldene Schnitt‘ zu, was gerne als das Mysterium der Schönheit bezeichnet wird und in zahllosen naturwissenschaftlichen und philosophischen Abhandlungen umkreist wird.
4
Die Wissenschaftsdisziplin der Ökonomie hingegen kennt ‚Schönheit‘ als konstitutives Element ihres Gedankengebäudes nicht. Wirtschaftswissenschaft kümmert sich um die Frage von Knappheiten von Gütern und wie durch einen markträumenden Preis ein Optimum in der Allokation, also in der Zuteilung von Ressourcen entsteht. Als Wirkungsmaß der Allokation dient der ‚Nutzen‘, wobei dies durch unmittelbaren Konsum wie auch durch Konsumverzicht – also in die Zukunft aufgeschobener Konsum – erzeugt werden kann. Was ich heute nicht konsumiere, spare ich und das Sparen – erzwungen durch den Staat oder freiwillig über das Bankensystem – ermöglicht Investition für die Zukunft. Dannzumal erzeugt dieser ‚aufgeschobene Konsum‘ im Besten der Fälle positiven Nutzen, zum Beispiel in Form von Grundversorgungsgütern und -dienstleistungen, vorausgesetzt, dieses Verhalten einen höheren Nutzen verspricht als der unmittelbare Verzehr der Ressource. Bei dieser modellhaften Vorstellung menschlichen Handelns sind zahlreiche Annahmen unterlegt. Eine davon ist die Verhaltensmaxime des Individuums: es optimiert oder maximiert den Nutzen seines Handelns. ‚Schönheit‘ kann sich daher tatsächlich in dem Konzept des Nutzens wiederfinden.
5
Menschliches Handeln erzeugt positive oder negative Externalitäten, also Effekte, die man nicht beabsichtigt hat, aber dennoch von ökonomischen Akteuren produziert werden. Der marktliche Austausch von Gütern und Dienstleistungen erfolgt über einen Preis – monetär bemessen oder nicht-monetär –, der aber in der Regel diese angesprochenen Externalitäten nicht im Preis miteinschließt – internalisiert. Zum Beispiel Lärm an stark befahrenen Autostraßen oder schöne Fassaden in der Altstadt. Die Ökonomie ist sich dieses Mangels bewusst und schlägt vor, die Konsumenten bzw. Produzenten durch Einschluss der Vermeidungskosten bei negativen Externalitäten oder durch Abgeltung von Vorteilslagen bei positiven Externalitäten zu kompensieren. Kann man diese Vor- und Nachteile abschätzen, also auch die Schönheit eines Artefakts, könnte man für deren Unterhalt und Bestand ein Preisschild setzen. Beeinträchtigungen von Landschaften durch Infrastrukturinterventionen oder visuelle Immissionen werden so in gewissen Ländern seit Jahrzehnten mit entsprechenden Bewertungsverfahren – contingent valuation – systematisch bewertet und durch die Verursacher entschädigt.
6
‘Schönheit’ wird seit Langem in den Wirtschaftswissenschaften empirisch untersucht.
Ahlfeldt und Mastro haben zum Beispiel im Jahre 2012 untersucht, wie hoch der Aufpreis von Hauskäufern ist, die sich im Umfeld von ikonischer Architektur angesiedelt haben. Der Analysegegenstand liegt in Oak Park, Illinois/USA, wo 24 Wohngebäude von Frank Lloyd Wright stehen, plus einer Vielzahl von weiteren erhaltenswerten Landschaftsobjekten.
Die angewandte ökonometrische Methode zeigt die Wirkung von positiven Externalitäten, die von aussergewöhnlicher Architektur – hier Wohngebäude – ausgeht. Hauskäufer haben eine Prämie von rund 8.5% innerhalb von 50-100m zum nächstgelegenen Wright-Wohnhaus gezahlt und immer noch rund 5% für eine Lage innerhalb von 50-250m. ‘Ikonische Architektur’ erzeugt als einen positiven externen Effekt, wenn auch hier die ‘Schönheit’ durch den Star-Status des Architekten angenähert ist.
7
Der Preisatlas der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner zu ‘Marktpreisen für Eigentumswohnungen’ in der Schweiz im Jahre 2023 zeigt ein erstaunliches Bild: die höchsten Preise werden nicht nur gezahlt in den Agglomerationsräumen von Zürich-Zug-Luzern, Basel oder am Genfersee. Auch in wenig dicht ausgestatteten, abgelegenen Gebieten wir im Oberengadin, in Zermatt, Verbier oder Gstaad finden sich die gleichartigen Preise für den Quadratmeter Wohnfläche. Wie kann das sein?
Das schweizerische Nationale Forschungsprogramm (NFP) „Landschaften und Lebensräume der Alpen“ hatte sich bereits anfangs der 2000er Jahre wissenschaftlich Gedanken zu Preisbildung und landschaftlicher Attraktivität gemacht und kam zum Schluss «Schönheit der Alpenlandschaft zahlt sich aus“. Dieses NFP hatte den Auftrag, Ziel- und Handlungswissen für eine gesellschaftlich erwünschte, wirtschaftlich tragbare und politisch umsetzbare Landschaftsentwicklung zu erarbeiten. Endogene und exogene Kausalitäten der Landschaftsentwicklung sollten erkannt, Anforderungen und Normen für eine nachhaltige Landschaftsentwicklung in den Alpen erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten in den relevanten Politik- und Handlungsfeldern aufgezeigt werden. Zwanzig Jahre später harren die erarbeiteten Erkenntnisse noch immer einer Umsetzung. Ist Politik also resistent gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen?
8
Der Psychologe Abraham Maslow hat vor langer Zeit schon postuliert, dass der Mensch sich entwickele entlang einer klar definierten Bedürfnishierarchie von basalen Existenzbedürfnissen bis hin zu Zugehörigkeit, Wertschätzung und Liebe. Die Wirtschaftswissenschaften – wie oben gezeigt – kennen zahlreiche empirische Studien, die zeigen, wie ‘Schönheit’ sich positiv auswirkt auf eine Reihe von ökonomischen und sozialen Lebenssituationen. Ebenso ist belegt, wie ästhetische Ortsbilder und Dorfkerne positiv die Zufriedenheit von lokalen Gemeinschaften beeinflussen; dazu zählt auch die ausreichende Ausstattung mit lokaler Versorgung aller Art (Florida et al., 2011). Handlungsanweisungen lassen sich daraus nicht direkt ableiten, denn die nachgewiesenen positiven Zusammenhänge kommen methodisch meist daher als mono-kausale Erkenntnisse. Wie immer ‘Schönheit’ auch definiert ist, isoliert ist sie nicht fassbar, sondern stellt sich als Ergebnis eines umfassenderen Prozesses ein, sozusagen als Attribut eines Produktes oder der Leichtigkeit einer Anwendung.
9
‘Schönheit’ scheint eine Renaissance zu erleben. Während der Covid-19 Pandemie wurde proklamiert ‘Landleben ist schön’ oder politische Initiativen der EU-Kommission schmücken sich mit dem Begriff ‘beautiful’ wie ein Langezeit vergessener Heilsbringer: «The New European Bauhaus is a creative and interdisciplinary initiative that connects the European Green Deal to our living spaces and experiences. The New European Bauhaus initiative calls on all of us to imagine and build together a sustainable and inclusive future that is beautiful for our eyes, minds, and souls”. Diese Initiative will die gesellschaftliche Transformation unterstützen mit Hilfe von drei miteinander verbunden Werten: “sustainability, from climate goals to circularity, zero pollution, and biodiversity; aesthetics, quality of experience and style beyond functionality; inclusion, from valuing diversity to securing accessibility and affordability” (URL: https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/about-initiative_en).
Ein Stück ‘holistischer’ noch treten einzelne Business-Initiativen auf, wie ‘The House of Beautiful Business’ (URL: https://houseofbeautifulbusiness.com), welches ‘beauty’ als ihre ‘Mission’ und die Lösung der heutigen multiplen Krisen anpreist: «To thrive in this new reality, we need a new language, a new north star, a new framework for business and life. One that is:
Not harsh but soft and tender
Not rigid but fluid and flexible
Not toxically positive but melancholic
Not numbers-oriented but poetic
Not risk-averse but imaginative
Not efficient but sustainable
Not “human-centered” but humane
Not all-knowing but willing to ask beautiful questions
In one word: one that is beautiful
This new practice will not come from business books or schools alone, but rather from economics, tech, science, the humanities, and the arts living together, under one roof”
(URL: https://houseofbeautifulbusiness.com/our-mission).
10
Klingt zu schön, um wahr zu werden – doch welche tiefreichenden Konsequenzen haben diese Ambitionen für die ‘Raumwende’? Wohlklingende Manifeste, punktuelle ikonische Architekturen, ‘Dorfverschönerung’, ästhetischer Denkmalschutz u.v.a.m. hellen vielleicht den Moment auf, sie verändern aber nicht den alles durchdringenden Fluss des Alltagshandelns. Die Teile hängen zusammen, das Ganze aber ist mehr als die Summe dieser einzelnen Infrastrukturen des Lebens. Wohnen, Arbeiten, Erholen, Bilden, Mobilität u.a. bilden einen multiplen, komplexen Vielklang. Wie also findet vernetztes Denken zu vernetztem Handeln und erzeugt letztlich absichtsvolle, vernetzte Wirkungen im Raum, welche die Menschen ansprechen, gar als ‘schön’ gelten könnten?
11
Der Soziologe Lucius Burckhardt hat vor Jahrzehnten bereits in eine wichtige Richtung gewiesen mit seinem Text «Design ist Unsichtbar» (Burckhardt 1980): „Natürlich kann man sie sehen, die Gegenstände des Designs; es sind Gestaltungen und Geräte bis hinauf zum Gebäude und bis hinab zum Dosenöffner. Der Designer gestaltet sie in sich logisch und gebrauchsfertig, wobei er gewisse äußere Rahmenbedingungen annimmt: beim Dosenöffner die Beschaffenheit von Dosen. Der Designer von Dosen geht wiederum davon aus, wie die Dosenöffner beschaffen sind; dieses ist seine Randbedingung. So kann man die Welt als eine Welt von Gegenständen auffassen und sie einteilen in – zum Beispiel – Häuser, Straßen, Verkehrsampeln, Kioske; in Kaffeemaschinen, Spültröge, Geschirr, Tischwäsche. Diese Einteilung hat Konsequenzen: Sie führt eben zu der Auffassung von Design, welche ein bestimmtes Gerät ausgrenzt, seine Außenbedingungen anerkennt und sich das Ziel setzt, eine bessere Kaffeemaschine zu bauen oder eine schönere, also das zu tun, was in den fünfziger Jahren mit der Auszeichnung Die Gute Form beachtet worden ist.
Wir können uns die Welt aber auch anders einteilen (…)».
Dann erwähnt Burckhardt den Architekturtheoretiker Christopher Alexander mit seiner ‘Pattern Language’ und fährt fort: «Sein Schnitt liegt nicht zwischen Haus, Straße und Kiosk, um bessere Häuser, Straßen und Kioske zu bauen, sondern er scheidet den integrierten Komplex Straßenecke gegen andere Komplexe ab; denn der Kiosk lebt davon, dann mein Bus noch nicht kommt, und ich eine Zeitung kaufe, und der Bus hält hier, weil mehrere Wege zusammenlaufen und die Umsteiger gleich Anschluss haben. Straßenecke ist nur die sichtbare Umschreibung des Phänomens, darüber hinaus enthält es Teile organisatorischer Systeme: Buslinien, Fahrpläne, Zeitschriftenverkauf, Ampelphasen usw.» Burckhardt zieht daraus den Schluss, dass auch diese Einteilung der Umwelt einen designerischen Impuls ergibt, der aber unsichtbare Teile des Systems einbezieht: «Erforderlich wäre vielleicht ein vereinfachtes Zahlungssystem für Zeitschriften, damit ich den Bus nicht verfehle, während ich die Münzen hervorklaube und der Verkäufer gerade einen anderen Kunden bedient. Manche werden nun wieder ein neues Gerät vor sich sehen, einen elektronisch summenden Zeitschriftenautomaten, wir aber einen Eingriff in das System: vereinheitlichte, runde Zeitschriftenpreise, oder Zeitungs-Abonnementkarten auf Sicht – jedenfalls eine Regelung, die sich mit der Institution der Zeitschriftenverteilung befasst“ (Burckhardt 1980: 187-189).
12
Thomas Sieverts hatte 1997 seine Analyse der suburbanisierten europäischen Stadtlandschaft publiziert (Sieverts 1997) und dafür den Begriff der ‘Zwischenstadt’ geprägt.
In seinem Kapitel 4 ‘Die Zwischenstadt als Gestaltungsfeld‘ finden sich Ausführungen zum vermeintlichen Gegensatz von ‘Ästhetik und Anästhetik’. Sieverts zitiert ausführlich Wolfgang Welsch, der sich ,Zur Aktualität ästhetischen Denkens’ wiederum auf französische Philosophen wie Derrida oder Lyotard bezieht. Sieverts zitiert hier Welsch zur Ästhetik, die mache «begreifbar, was die Traditionalisten des Schönen nie und nimmer begreifen werden: daß es heute, paradox gesprochen, auf die Wahrnehmung des Nicht-Wahrnehmbaren ankommt, daß es um Aufmerksamkeit auf die Grenzen und das Jenseits der unmittelbaren Wahrnehmung geht» (Welsch, in Sieverts 1997, 107). Sieverts wendet diesen Gedankengang auf ästhetische Aspekte der Zwischenstadt an, in der das Anästhetische, das normalerweise nicht bewußt Wahrgenommene, ein übermächtiges Gewicht habe (Sieverts 1997, 108). Daraus folgt: «Erst die Sensibilisierung für ihre große anästhetische Seite, die ja das Ergebnis
unzähliger ,gefühlloser‘ rationaler Entscheidungen darstellt, kann den Weg bahnen zu einem anderen Umgang mit der Zwischenstadt» (Sieverts 1997, 109). Als Komplement hebt Sieverts aber auch die Bedeutung hervor von Robert Venturi, Denise Scott-Brown und Steven Izenour mit ihrem Buch ‘Learning from Las Vegas’ (1972); diese ‘entdecken’ die Schönheit des vulgären nordamerikanischen ‘commercial strips’ und öffneten dem Publikum im Anschluß an die Pop Art die Augen für die Zeichenwelt der ordinären Vorstädte und ihres eigenartigen ästhetischen Reizes.
13
Die eingangs dieses Beitrages gestellte Frage ‘Wie kann man ökonomische Logiken dazu bringen, nachhaltig Schönheit zu produzieren?’ lässt sich gewinnbringender im grösseren Kontext von Ideengeschichte und aktueller Raumproduktion erläutern. Eine eindeutige Antwort erscheint mir persönlich nicht ratsam. Nutzenstiftende, ressourceneffiziente und integrierte Planung und Gestaltung – also absichtsvolle Wirkung erzeugen – könnte, wenn man Lucius Burckhardts Gedanken weiterspinnt, eine Form von systemimmanenter ‘Schönheit’ schaffen. Äusserlich nicht den gängigen Attributen von ‘das ist aber schön!’ entsprechend, aber im Inneren, also im Gebrauch als soziales und räumliches Gesamtsystem, kann ein Design von morgen entstehen. Das besteht aus den geeigneten und ökonomisch effizienten Produktlösungen, Co-Creation-Prozessen und der zwischenmenschlichen ‘Awareness’, dass nur so dauerhaft tragfähige und ‘schöne’ Wirkungen im Raum erzeugt werden können.
14
Hier stehenbleiben reicht dennoch nicht aus. Mit dem Aufkommen der Social Media Plattformen und den mobilen Handcomputern – das erste iPhone kommt am 9. November 2007 auf den Markt – erhält die oben angeführte Plattitüde – „Beauty is in the eye of the beholder” – eine vollständig neue Bedeutung. Über Jahrhunderte haben die Produzenten von Architektur oder genereller, von menschgemachten Artefakten, die Definitionshoheit ihrer Ergebnisse in Händen gehalten. Die Architektin, der Architekt, der Ingenieur, die Künstlerin bestimmten gleichsam aus der Angebotssicht die Wahrnehmung und den Bedeutungsgehalt des betreffenden Artefakts. Kulturinstitutionen stellten entsprechend beauftragte Fotografien für die Medien zum Download auf ihren Websites bereit. Architekturbüros schmückten ihre Portfolios mit menschenleeren Architekturfotografien. Das hat sich radikal verändert. Die Mobilgeräte und die digitalen Plattformen spielen nun den Nutzerinnen und Nutzer die Definitionsmacht in die Hände. Milliarden von ‘User’ zeigen, was gefällt und wie das Abgebildete wahrgenommen wird; die Währung dafür sind die Re-Posts, Likes, Re-Tweets, Impressions u.sw. So kann man zum Beispiel in Echtzeit das Entstehen von Architekturikonen mitverfolgen bzw. wissenschaftlich analysieren, was wir in einem Team an der TU München mit dem im Herbst 2021 in Rotterdam eröffneten Depot Boijmans, entwickelt von MVRDV, publiziert haben (Alaily-Mattar et al., 2023).
15
Das als ‘schön’ empfundene Ganze ist mehr als die Summe seiner auf Effizienz getrimmten Binnenlogiken der Einzelteile. Star Architecture und ‘Vernacular Architecture’ sind keine Gegensätze; das Alltägliche und Gewöhnliche lebt im Wechselspiel mit dem Speziellen und Ikonenhaften. Vernetztes Denken und vernetztes Handeln wären Ansätze, fragmentierte Aktivitäten und silo-artige Organisationsstrukturen aufzuweichen. Durch entwerferische Synthese von vermeintlich unverbundenen Informationen erwächst Wirkung – und absichtsvolle Wirkungen sind stärker als hehre Ziele. In unserer Welt der sehr knappen Ressourcen und der Aufmerksamkeitsökonomie hilft diese Erkenntnis vielleicht ein wenig für die dringend anstehenden räumlichen Transformationen.
Quellen/Literatur:
(1) Ahlfeldt, Gabriel M. und Alexandra Mastro (2012): Valuing iconic design: Frank Lloyd Wright architecture in Oak Park, Illinois. In: Housing Studies 27(8), 1079-1099. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2012.728575.
(2) Alaily-Mattar, Nadia, Diane Arvanitakis, Hanna Krohberger, Lukas Franz Legner und Alain Thierstein (2023): The performance of exceptional public buildings on social media–The case of Depot Boijmans. In: PLOS ONE 18(2), e0282299. doi: 10.1371/journal.pone.0282299.
(3) Burckhardt, Lucius (1980): Design ist unsichtbar. In: Jesko Fezer und Martin Schmitz (Hrsg.): Wer plant die Planung? Architektur, Politik und Mensch. Berlin: Martin Schmitz Verlag, 187-199.
(4) Florida, Richard, Charlotta Mellander und Kevin Stolarick (2011): Beautiful Places: The Role of Perceived Aesthetic Beauty in Community Satisfaction. In: Regional Studies 45(1), 33-48.
doi:10.1080/00343404.2010.486784.
(5) Sieverts, Thomas (1997): Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land. Serie: Bauwelt Fundamente, Bd. 118. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg Verlag.
[Beitrag von Prof. Dr. Alain Thierstein, TU München, Department Architektur, LG Bayern]
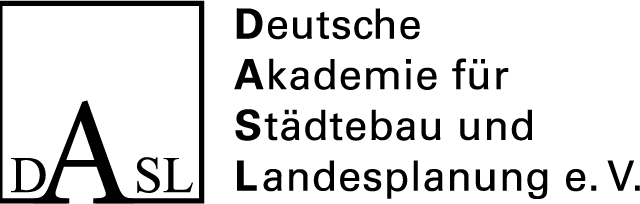
Pingback: Wie wenig ist genug? – Quartiere machen