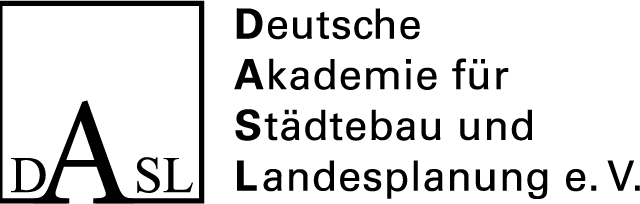Kirchturmdenken oder Kooperation. Jeder für sich oder doch besser gemeinsam? Wann lohnen sich Kooperationen mit anderen?

Quelle: Prof. Dr. Matthias Ottmann
“Wenn Du nicht so drücken würdest, müsste ich nicht so drücken.“ (K. Sprenger)
Kooperationen besitzen in der Stadtplanung eine lange Tradition. Kooperationen sind in der Anbahnung vielen Widrigkeiten ausgesetzt. Sind sie einmal in Kraft gesetzt, heißt es noch lange nicht, dass die Erwartungen erfüllt werden. Signale, die im Vorfeld gesendet werden, können uns als Verhandlungspartner schon früh überzeugen, dass wir auf den richtigen Partner gesetzt haben. Aber warum Partnerschaft oder gar Kooperation?
Vereinbarungen zwischen Kommunen sowie zwischen Kommunen und privaten Eigentümern und Bauherrn bilden häufig die Grundlage für eine städtische Entwicklung. Wünsche und Erwartungshaltungen sind aufeinander abzustimmen, und leider führt nicht jeder Weg zum Ziel. Aus diesem Grund ein kleiner Überblick über mögliche Fallstricke, die sich vermeiden lassen:
- Kirchturmdenken ist ein bewährtes Verhaltensmuster, dem wir uns nur schwer entziehen können. Häufig ist das gepaart mit Tonangebern oder Meinungsführern, da ist es schwierig durchzudringen oder nach Alternativen zu suchen. Das „Einmauern“ wird durch historische Referenzen bestärkt und beschädigtes Vertrauen ins Feld geführt. Um diese Haltung zu untermauern, unterstellen wir nicht nur ein Motiv, sondern vermuten vielmehr eine hidden story, denn niemand wird wohl von sich aus mildtätig sein. Hier kann nur immer wieder beständig betont werden, dass eine Kooperation auch Vorteile mit sich bringt, gerade dann, wenn wir auf Expertenwissen fachlich versierter Akteure angewiesen sind und auf einen Mehrwert hoffen können, indem wir einen möglichen Vertragspartner ins Vertrauen ziehen.
- Fair Play ist die Grundlage für ein ausgewogenes Interessensverhältnis. Es nützt keiner Partei, keiner Kommune und keinem Eigentümer, wenn man seine eigene Vorstellungen bis auf das Letzte meint durchzusetzen. Wenn eine Überreizung vorliegt und die Interessen nicht risikoadäquat zwischen den Partnern verteilt werden, kann es zu einem Abbruch kommen. Damit ist niemanden gedient, und beide tragen nun einen deutlich höheren Verlust, wenn die Geschäftsgrundlage nicht mehr besteht.
- Never change a winning team ist ein wunderbarer Satz, der uns darin bestärkt, bereits bestehende Geschäftskontakte auch weiter zu bemühen, wenn sich der Erfolg einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit schon eingestellt hat. Geschäftspartner, sei es Projektentwickler, die ihr Versprechen einhalten, wie Kommunen, die sich an mündlichen Zusagen halten, sind an dem Aufbau und der Verstetigung ihrer Reputation interessiert.
- Verstetigung ist gut, aber wie verhalten wir uns mit einer neuen Partnerschaft? Jede Form von Verhandeln kann nur mit einem gewissen Vorurteil beginnen, noch bevor unsere eigene Position eigentlich klar ist. Wenn wir in eine Verhandlung gehen, kann uns teilweise ein zu eng gesteckter Rahmen behindern. Vorurteile gibt es hüben wie drüben: es gibt sicherlich viele Gründe, die uns zunächst einmal an einem gemeinsamen Tun zweifeln lassen. Wie können wir uns auf eine Grundlage einigen, wenn die Erwartungshaltung, die uns entgegengebracht wird, viel zu hoch ist? Und wie schafft man es die Vorurteile zu durchbrechen, so dass Akteure auf einer gleichen Ebene agieren und sich begegnen können?
- Häufig überwiegt dann schnell auch die Meinung, dass der eine oder andere „über den Tisch gezogen wird.“ Wie können wir aber vermeiden, dass dieser Eindruck entsteht oder wir tatsächlich Gefahr laufen, dass uns die vertragliche Anbahnung nicht überzeugt? Häufig wird dabei übersehen, dass die jeweilige Vertragspartei auch Gremienarbeit zu leisten hat. Konsensuales Handeln beginnt dort, wo wir Vielstimmigkeit zulassen und uns in einer eigenen Meinungsbildung nähern. Kommunalverwaltung, Gemeinderat und die Vorstellungen des Bürgermeisters übereinzubringen, ist sicherlich so schwer wie eine Erbengemeinschaft einer oder mehrerer Grundstücke unter einen Hut zu bringen.
- Auf Zeit spielen. Stärken und Schwächen in der Vertragsanbahnung auszuspielen und ggf. seine eigene Position länger vorzuhalten oder Beschlüsse „auf die lange Bank“ zu schieben, sind bewährte Verhandlungstaktiken, ob sie nun bewusst gewählt oder durch die Gremienarbeit geschuldet sind. Bei fast jedem Fortbildungsprogramm zum Thema: „Wie verhandle ich richtig“ wird darüber gesprochen, wer das erste Angebot auf den Tisch legt und damit eine Erwartungshaltung erzeugt, und wie man sich im Zeitablauf danach verhält.
Die Akteure weisen unterschiedliche Zeitpräferenzen auf. Wer eine zeitnahe Entscheidung verlangt, ist häufig im Nachteil. Diejenige Partei, die es sich leisten kann auf Zeit zu spielen, kann dieses taktische Instrument einsetzen, aber auch nur so lange, bis sich die andere Partei nicht anders entscheidet und ggf. von einer möglichen Vereinbarung abwendet. - Was ist möglich und was können wir durchsetzen? Jede Form von Kooperation enthält auch eine gewisse Bazar-Stimmung. Verhandeln und seine eigene Position klar zu artikulieren, hilft der anderen Partei zu wissen, welche Vertragsbestandteile wichtig sind (so genannte no-gos) oder wo Verhandlungsbereitschaft besteht. Ohne Emotion können wir niemals zu einem guten Ergebnis kommen, auch Scheitern muss schmerzhaft sein.
Denn Kooperation beginnt dort, wo wir uns über den möglichen Verhandlungsraum unseres Gegenübers klar werden: wo drückt der Schuh? Wo können wir ansetzen? Wie lautet unsere Erwartungshaltung und wie können wir sie bestmöglich abstimmen? Wir können dabei nur an vernunftbezogenes Handeln appellieren und transparent kommunizieren. - Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt (von Eschenbach). Dieser gerade heutzutage gültige Satz enthält eine implizite Verhandlungsform. Es ist nicht klar, ob eine Gegenleistung erwartet wird, auch kein Versprechen, dass damit erwartet wird. Es ist jedoch mehr als eine Geste, eine Offenheit, ein Vertrauen, das als Grundlage gesetzt wird. Häufig dient dies bereits im Vorfeld einer Anbahnung zu einem möglichen Vertrauensvorschuss als Grundlage für eine nachhaltige Kooperation.
- Jeder für sich oder doch besser gemeinsam? Es gibt viele Gründe, die uns lehren, eine Kooperation einzugehen. Nur derjenige, der es böse mit uns meint, wird bald als solcher zu erkennen sein, da entweder der Eindruck der Übervorteilung entsteht oder der „Exit“ bald zu erkennen ist. Strategien, die nicht auf den Vorteil der Gemeinschaft ausgerichtet sind, lassen sich früh identifizieren, das lehrt auch die mittlerweile in der Wirtschaftstheorie etablierte Spieltheorie.
Wo ein Wille, da ein Weg. Kooperationen können uns helfen, wenn wir selbst den Lösungsraum nicht füllen können oder wenn wir ihn nicht einmal erkennen können. Nach den Spielregeln der Vernunft werden wir uns dann für eine Kooperation aussprechen, wenn wir in unserer eigenen Gesamtheit überfordert sind, ein gestecktes Ziel zu erreichen. Wir wenden uns an mögliche Vertragspartner in der Hoffnung auf einen gemeinsamen Mehrwert. Und ja, dieser kann entstehen, dieser kann sogar dauerhaft entstehen und wirken, wenn das Versprechen eingelöst wird und ein Vertrauen aufgebaut wird. Kooperationen sind sinnvoll, wenn wir einen Mehrwert für die Gemeinschaft herbeiführen wollen. Kooperation ist weder einseitige Willenserklärung noch dogmatisch vorgegeben. Sie ist auch nicht Erfüllungsgehilfe, um unsere eigenen Überzeugungen durchzusetzen. Kooperationen sind eine vernunftbasierte Willenserklärung, einen besseren Zustand zu erreichen, und dies auf der Grundlage einer ausgewogenen Abwägung und in Erfüllung partnerschaftlicher Interessen.
[Beitrag von Prof. Dr. Matthias Ottmann, Urban Progress GmbH, LG Bayern]