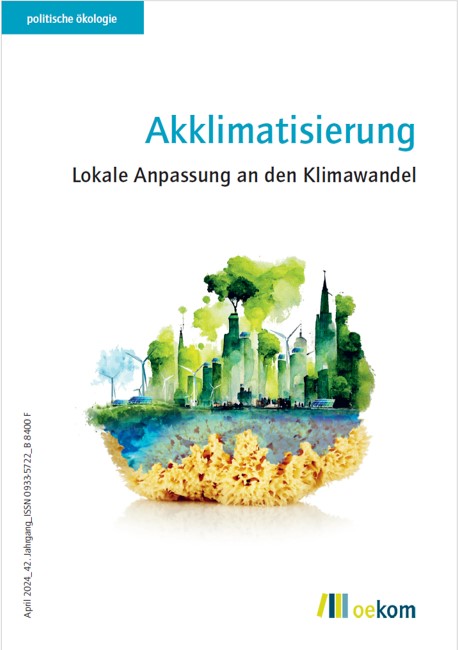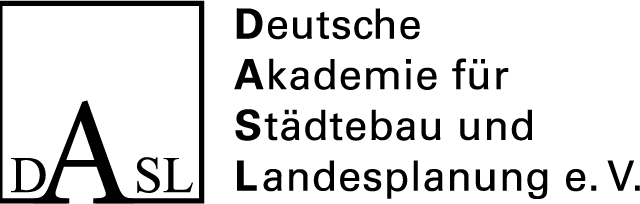Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Ing. Ingrid Krau, Landesgruppe Bayern
Evidenz ist der Zentralbegriff der modernen empirischen Wissenschaften. Nach Wikipedia liefert Evidenz unbezweifelbare Einsichten mit Hilfe von Beweismaterial, das erlaubt, Hypothesen von gesichertem Wissen zu unterscheiden. Wie tauglich ist der Begriff, um die „Anpassung an den Klimawandel“ zu erfassen?
Das Umweltbundesamt (UBA) beabsichtigt, “Kosten und Nutzen von Anpassungsmaßnahmen“ zu bewerten und hat dazu einen Rahmen (Frame) aufgespannt. Es möchte so den Planenden verlässliches Wissen und Kriterien zu „guter Praxis der Anpassung an den Klimawandel“ zur Verfügung stellen. Noch ist das entworfene und auf der Homepage einsehbare Ordnungsgerüst leer, enthält noch keine Inhalte, die Kästchen sollen Schritt um Schritt mit Beispielen und Erkenntnissen aufgefüllt werden. (www.umweltbundesamt.de/publikationen/ gesichtet Anfang April 2024)
Dass das keineswegs zu früh ist, sondern überfällig, betont auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke, wenn sie feststellt, dass uns Ausmaß und Folgen des Klimawandels früher und heftiger erreichen, als wir und die Wissenschaft angenommen haben. Es gibt also umfassenden Analyse- und Handlungsbedarf, der nun post festum und begleitend erforderlich ist.
Da Anpassungsmaßnahmen komplexer Wirkung sind, werden vom UBA mit Vorrang erfolgreiche Beispiele analysiert; so das von Akira Miyawaki realisierte Beispiel der Tiny Forests, das die positive Wirkung hochdiverser Miniwälder im urbanen Raum zeigt. Entscheidend für das positive Urteil ist ihre Funktion als grünes Klassenzimmer und nicht zuletzt, dass sie den heißen Sommer hervorragend überstanden haben; einleuchtend und pragmatisch.
Die evidenzbasierte Analyse von bereits realisierten Beispielen unterzieht diese also der nachträglichen Erfolgskontrolle. Der Wirkungsgrad des flott hingezeichneten Fassadengrüns muss sich also beweisen, um zum vertrauenswürdigen Vorbild für weitere Projekte zu werden und so die Folgen des Klimawandels erfolgreich zu zähmen.
Doch wir fangen nicht am Nullpunkt an: wir haben bereits das Klimaanpassungsgesetz vom 20.12.2023. Sein Ziel ist, „zum Schutz von Leben und Gesundheit, von Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur sowie von Natur und Ökosystemen negative Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere die drohenden Schäden zu vermeiden oder, soweit sie nicht vermieden werden können, weitestgehend zu reduzieren“. Das freundlich wirkende Fassadengrün ist längst zu einer wohlfeilen Musterlösung geworden, die Anpassung ans Klima suggeriert, oft ohne Rücksicht auf den Kontext der Umgebung.
Wohlwollend und ans Gute glaubend lesen wir die grünen Beispiele unserer inzwischen stark versiegelten Großstädte: sehen, wie sie gegen den fortlaufenden Prozess der Schmälerung des Stadtgrüns ankämpfen und gegen den damit verbundenen Verlust des Wasseraustausches mit dem Boden. Das Konzept der klimagerechten Schwammstadt, wie einleuchtend auf dem Titelbild der politischen Ökologie Nr.176 dargestellt (Abbildung), ist für Planende und Laien zur echten Erkenntnis geworden, an der die hochkomplexen Klimawirkungen bildhaft erkannt und somit gedacht werden können. Mit zusätzlichem Wissen erlaubt es uns, Handlungsanweisungen abzuleiten. Denn der Weg vom Wissen zum Tun verlangt stets gründliche vorausgehenden Schritte glasklarer Analyse der Wirkungen, der Materialien, Luftströmungen und Temperaturen,
um zu erfolgreicher Praxis zu werden, aber eben auch der Beobachtung im Nachhinein.
Wesentliche Voraussetzung zu unseren neuen Erkenntnissen war die Entwicklung des neuen Erdbeobachtungsprogramms COPERNICUS der Europäischen Weltraumorganisation ESA, das seit 2014 über seine ständig weiter entwickelten Sentinel-Satelliten die Erdoberfläche von oben in den Blick nimmt. Anstelle des aufregenden Blicks ins Weltall richten diese Satelliten ihr Auge in hoher Auflösung erdwärts und zeigen uns gnadenlos das Bild der derzeitigen terrestischen Misere. Sie lieferten uns mit der Sicht auf die große neue Dürrezone von Skopje bis ins Wiener Becken und auf die dicht besiedelte Landeshauptstadt Wien die alarmierende Erkenntnis der von 2021 bis 2023 stetig angestiegenen sommerlichen Hitzebelastung und Austrocknung der Großstädte, aber auch weiter landwirtschaftlich genutzter Flächen.
Wie können sich die dicht versiegelten Städte gegen die Auswirkungen des Klimawandels aufrüsten? Hier im Bestand fängt ja unsere trans- und interdisziplinäre Arbeit erst so richtig an: Wir werden die schönen Ideen sprühender Tröpfchenberieselung von Plätzen und kühlender Nässe ab jetzt viel genauer beobachten müssen. Wie viel bewirken die Feuchtemaßnahmen in die nähere Umgebung hinein, machen sie beliebige Nachverdichtung wett? Es besteht weiter eine große Lücke zwischen den politischen Klimazielen und den tatsächlichen Fortschritten in der Umsetzung. Das Wort Nachhaltigkeit ist zur Allzeitmetapher degradiert, ihre Mantras ermüden in Oberflächlichkeit. Wir brauchen einen neuen Elan genauer Beobachtung.
NRW hat sich bereits 2013 ein Klimaschutzgesetz mit konkreten Zielen gegeben – als erstes Bundesland. Aber dennoch ist es weiter das Bundesland, das in seiner Mobilität am stärksten auf den MIV, zudem mit weiterhin umfassendem Einsatz von Verbrennern, angewiesen ist, allen anerkannten Anstrengungen, den ÖPNV flächendeckend auszubauen zum Trotz.
Gesetz und Umsetzung klaffen nicht nur in NRW weit auseinander.
Noch taufrisch ist nun aber das am heutigen 15. April 2024 aufgeweichte bisherige Klimaschutzgesetz, verändert für ganz Deutschland, damit die Emissionen des Verkehrs das Zulässige nicht weiter übertreffen, wurde das Gesetz zurückgenommen. Überschreitungen dürfen künftig mit Einsparungen anderer Sektoren verrechnet werden und das für den um zehn Jahre verlängerten Zeitraum bis 2040. Auch der Gebäudesektor, der weiterhin die Leine reißt, wird den neuen Regelungen folgen dürfen.
Der erhoffte institutionelle und instrumentelle Rahmen, der die Anpassung an die bestehenden Herausforderungen schaffen sollte – so die Hoffnung am IÖR – wird daher ebenso nicht aktiv und gestaltend werden können. Die Institutionen werden sich an das geänderte Gesetz anpassen müssen.
Gesicherte Gewohnheiten werden weiter zu Handlungsträgheit verführen. Erst zunehmende Not wird im Umweltsektor erfinderisch machen, was letztlich auch für das urbane Überleben gilt. Der Blick auf die Zeit seit 1945 lehrt, dass man mit sehr viel weniger an persönlichen Ressourcen auskommen kann. Vollbesetzte PKW mit Fahrgemeinschaften und der Fahrrad- und Fußwegeverkehr zeigen auch heute noch, dass wir vieles selbst in der Hand haben. Die auf Papier und am PC erdachten Denkgebäude brauchen die handfesten Pioniere, die sie erproben und zu neuen Gewohnheiten machen.
Weniger Planung, mehr hands on? Vom Wissen zum Handeln? Aktionspläne sind gut, aber wer hält sich zwingend daran? Wie kommen sie aus den Denkzirkeln heraus? Wer gibt Rückmeldung?
Vieles wird nur wirksam, wenn wesentliche Erkenntnisse bereits verfügbar und Gemeingut geworden sind und einen individuellen Nutzen einschließen. Z.B. neuen bezahlbaren Wohnraum, der außerhalb der Regeln des Wohnungsmarkts für Bedürftige, Berufe der Daseinsvorsorge und andere prioritäre Berufsgruppen zur Verfügung gestellt wird und anschließend in die vorsorgende Allzeitreserve zurückfällt.
Bremen:
Da die Jahrestagung in Bremen stattfindet, liegt es nahe, für die Stadtplanung einen Langzeitrückblick zu riskieren:
Angesichts der riesigen Bremer Wohnungsnot mit einem Defizit von 100.000 Wohnungen nach 1945 war schnelles Handeln gefragt, es wurde die Stunde der Ellbogenplaner mit Manneskraft wie Ernst May, Bernhard Reichow und weiteren, die über die Bremer Wohnungsbaugesellschaft Gewofag und zeitweise über die Neue Heimat umfassende Handlungsmacht vereinten. So entstanden allein 1957-1970 mit dem Bau der NEUEN VAHR 11.800 Neubauwohnungen für 30.000 Einwohner, überwiegend im Zeilenbau errichtet, mit Fernwärme versorgt, weitgehend durchgrünt, 1970 um ein Einkaufszentrum und 1977 um ein Bürgerhaus angereichert ( Einwohnerhöchststand 1975 mit 33.700 Bewohnern); ein Beirat nach politischem Proporz sicherte den Konsens.
Eine stolze Bilanz, aus heutigem Blick zurück eine gigantische Leistung just in time. Und auch heute sind die Wohnungen der Neuen Vahr unersetzlich, auch in ihrer Gleichheit, die das soziale Phänomen, undifferenziert zu den Vahraonen zu gehören, unverbrüchlich zusammenschweißt. Sven Regeners Roman Neue Vahr von 2004 setzt diese Zusammengehörigkeit mit ihren unerbittlichen Komissregeln für die in der lokalen Kaserne aus der NS-Zeit ihren Grundwehrdienst Ableistenden perfekt in Szene.
Der Roman steht bleibend für den heutigen Mangel, bedarfsgerecht bezahlbaren Wohnraum neu zu schaffen. Denn der muss ja erst einmal da sein, um von den Benutzern angeeignet und mit Leben gefüllt zu werden. Behindert durch Markt, Immobilienwirtschaft, Assetfinanzialisierung der großen Banken und das eiserne Gesetz auslaufender Bindungswirkungen im nicht auf Dauer gesicherten bezahlbaren Wohnungsbestand gelingt weder Bremen noch München die notwendige Wohnungsversorgung.
Gestaltungsmaximen und Differenzierungen neu geplanter Wohnungsbestände täuschen über diesen Mangel der Daseinsvorsorge für die in die Großstädte Zuziehenden nicht hinweg. Als die die diesjährige Jahrestagung ausrichtende Landesgruppe der DASL ist festzuhalten, es bleibt jedenfalls in München Mängelverwaltung, zu deren Behebung auch die Gemeinden der Region kaum beitragen wollen. Die aus der Not geborene Nachverdichtung des Münchner Stadtgebiets kann nicht greifen, überall sichtbar sind die Folgen zunehmender Obdachlosigkeit, möge es als Interim unterlassenen Bauens dem Klimaschutz nützen, die vergeblich Wohnung Suchenden sind die Opfer.