Wo müssen wir ansetzen, um schnell wirksam zu werden? Wie müssen sich unsere Instrumentarien anpassen, um Verständnis und Lenkungswirkung für Veränderungsprozesse zu entfalten? Wen brauchen wir als Verbündete?
A. Mindshift
These:
Als Stadt_Landschaftsplaner*innen befreien wir uns vom quantitativen Wachstum und akzeptieren Ungewissheit und Grenzen der Planung. Wir suchen nach einem zukunftsfähigen Mensch-Natur-Verhältnis. Statt MEHR VOM GLEICHEN wollen wir WENIGER UND BESSER.
Instrumente:
Unsere Profession ist in einem Transformationsprozess. Die Berliner Erklärung der DASL, das Manifest „Das Haus der Erde“ des BDA und Organisationen und Initiativen wie Architects for Future, Bauhaus Erde oder das New European Bauhaus der EU dokumentieren Dringlichkeit und Möglichkeiten eines neuen Welt- und Berufsverständnisses.

Quelle: Reiss-Schmidt
B. Räumliche Gerechtigkeit
These:
Raumplanung wird nur dann als zukunftsgestaltende Kraft von der Gesellschaft akzeptiert, wenn sie demokratisch legitimiert ist und transparent und kooperativ arbeitet. Als Anwältin des Gemeinwohls fördert sie mit Strategien und Konzepten räumliche Gerechtigkeit.
Instrumente:
Ein tatsächlicher oder empfundener Mangel an Gerechtigkeit ist eine der wesentlichen Ursachen für die Abkehr von einer demokratischen und offenen Gesellschaft. Eine kooperative und koproduktive Raumentwicklung in Stadt und Land trägt dazu bei, diese Entfremdung zu stoppen und positive transformative Energien der Zivilgesellschaft freizusetzen.
C. Neue Allmende
These:
Boden ist wie Luft und Wasser ein unvermehrbares und unverzichtbares Gemeingut. Boden als handelbare Finanzanlage und Spekulationsobjekt verhindert eine soziale, klimagerechte, sparsame und dem Kreislaufprinzip folgende Landnutzung.
Instrumente:
Immer mehr Städte und Gemeinden betreiben eine aktive, gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, entziehen Boden der Spekulation und erweitern damit den Gestaltungsspielraum für gemeinwohlorientierte Landnutzungen.
D. Bündnisse
These:
Wenn Transformation gelingen soll, muss sie von Einsicht und Veränderungswillen der lokalen Akteure getragen werden – und von Vertrauen in deren Eigenverantwortung.
Instrumente:
Dazu müssen wir in den planenden Disziplinen und in Politik und Zivilgesellschaft Verbündete suchen, z.B. Landnutzer*innen mit Nachhaltigkeitszielen (biologische Landwirtschaft, erneuerbare Energieerzeugung etc.), zivilgesellschaftliche Initiativen für Klima- und Naturschutz, Boden- und Wohnungspolitik, praxisbezogene Wissenschaftler*innen

Quelle: Reiss-Schmidt
E. Handeln
These:
Wir versuchen, durch Beispiele, Pionierprojekte, Bilder etc. Aufbruchstimmung und Lust am Anfangen zu verstärken. Experimentierräume, Evaluierung und Fehlerkultur erleichtern den Weg vom Wissen zum Handeln. Kleine Schritte mit erlebbaren Wirkungen gilt es mit dem Blick für das Ganze zu und dem langen Atem für komplexe räumliche Transformationen zu kombinieren.
Instrumente:
Integriertes, transdisziplinäres Planen und Handeln sprengt die Grenzen sektoraler Strategien. Das erfordert eine andere Organisation von Prozessen und eine Zusammenführung der sektoral strukturierten rechtlichen und ökonomischen Steuerungsinstrumente.
F. Neue Instrumente
These:
Eine sozial- und klimagerechte Raumentwicklung braucht integrierte rechtliche und ökonomische Steuerungsinstrumente:
Instrumente:
Erweiterte demokratische Willensbildung – z.B. Gesellschafts- bzw. Bürger*innenräte
Räumliche Planung und Klimaschutz/-anpassung integrieren – „Transformationsgesetzbuch“ statt Baugesetzbuch, räumliche Entwicklung nur innerhalb der planetaren Grenzen
Mehrfachnutzungen erleichtern – vertikale und horizontale Mehrfachcodierung als Regelfall
Mehr Spielräume für Experimente – Festsetzung multifunktionaler Transformations- und
Experimentierräume (LEP, Regionalplan, Flächennutzungsplan)
Klimaschutz und Finanzpolitik zusammendenken – Abbau klimaschädlicher Subventionen
Kostenwahrheit der Raumnutzung verbessern -Wiederverwendung/Mehrfachnutzung von Flächen steuerlich begünstigen, Flächenversiegelungsabgabe, Planungswertausgleich
[Beitrag von Stephan Reiß-Schmidt, LG Bayern]
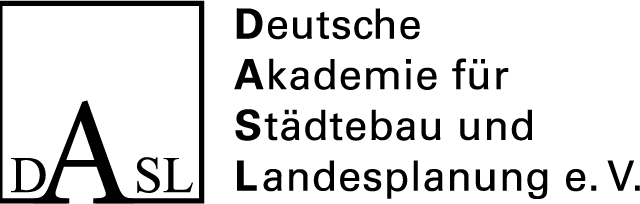
Pingback: Landesgruppe Bayern – Quartiere machen
Pingback: Wie wenig ist genug? – Quartiere machen