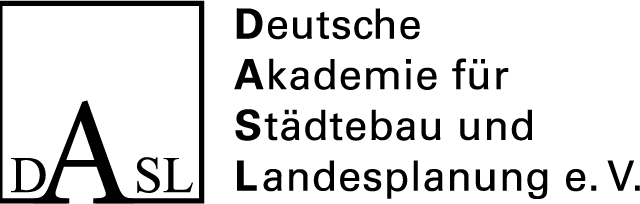Christina Tillmans, Studierende an der Hochschule Bremen
Beitrag aus dem Seminar „Quartiersforschung“ im Lehrgebiet „Theorie der Stadt“ an der School of Architecture Bremen, WiSe 2023/2024.
Das Quartier, einerseits eingebettet im professionellen Kontext der Planung und Optimierung unserer Städte, ist auch untrennbar verbunden mit der Lebenswirklichkeit eines jeden (Stadt-) Menschen. Aber was genau ist ein solches Quartier, wovon ist es abhängig und warum ist es als Bezugsgröße so besonders und bedeutsam?

Städtische Quartiere
Quartiere können als die Bruchstücke der Gesamtstadt betrachtet werden, angewiesen auf eine sinnvolle bauliche Struktur und vor allem auf funktionierende soziale Auseinandersetzung und Zusammenarbeit (vgl. Schnur 2021: S.54). Im Sprachgebrauch wird der Begriff Quartier auch als Bezeichnung einer Unterkunft genutzt (vgl. Duden 2023) und unter anderem mit einem Ort der Regeneration assoziiert. Doch die Kanten dieser städtischen Bruchstücke zu definieren, bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Die Grenzen eines städtebaulich-sozialen Quartiers als mehrdimensionaler Raum werden erst individuell, durch eigene Wahrnehmung und Zugehörigkeitsgefühle gefestigt (vgl. Willinger 2012: S.2).
Einerseits räumliche „Grauzonen“ (Schnur 2021: S.54), gehören Quartiere andererseits zur realen Alltagswelt der Bewohner. Sie dienen nicht nur als eine Zuordnung zu Ortsbezeichnungen auf der Stadtkarte, sondern auch als eine Quelle in Form von „Bezugs- Handlungs- und Ressourcenorten“ (ebd.). Wer das Quartier bewohnt und bespielt, teilt mit den anderen Bewohnern unmittelbare Betroffenheit. Und bekommt die Chance geboten, hier im kleinen Maßstab selbst wirksam zu werden und das eigene Wirken direkt zu erleben (vgl. Willinger 2012: S.7).
Auch wenn in der Konzeption der Quartiere oft Ideal- und Leitbilder zurate gezogen werden, können Quartiere nicht als vorgefertigte Kulissen (vgl. Kates 2000: S.93 ff.) erstellt werden – sondern müssen sich durch Wandelbarkeit und Unterschiedlichkeit in der Realität bewähren und weiterentwickeln (vgl. Schnur 2021: S.55). Nicht zuletzt enthält das Quartier den Wohnort bzw. das Zuhause und ist damit der Ausgangspunkt aller Beziehungen auch über die Schwellen des Quartiers hinaus in die umgebende Welt (vgl. Willinger 2012: S.1).
Auch in der Politik und Fachliteratur bleiben die zahlreichen Potentiale städtischer Quartiere nicht unbeachtet. Die Überschneidungen zu Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, Wirtschaft oder Migration, auch im nationalen oder regionalen Kontext, sind vielfältig. Auf Ebene des Quartiers stellt sich die „Alltagstauglichkeit unserer Städte“ auf die Probe und die „Wechselwirkungen zwischen Städtebau und dem täglichen Handeln“ werden erst sichtbar (Feldtkeller 2012). Längst ist deutlich geworden, dass „Zeiten und Räume der Stadt“ (Läpple; Mückenberger; Oßenbrügge 2010) im Wandel begriffen sind und der Umgang mit den Veränderungsprozessen die Städte außerordentlich prägt.
Das Beispiel “Seaside”
Ein besonders anschauliches Negativbeispiel wird von Ronald Kates unter der Überschrift „New Urbanism meets Cinematic Fantasyland: Seaside, „The Truman Show“ and New Utopias“ (Kates 2000) untersucht. Der fiktiven Stadt Seahaven aus der Verfilmung von 1998 liegt die reale Stadt Seaside im US- Bundesstaat Florida zugrunde, die sich perfekt als Filmkulisse für die scheinbar idealtypische und unveränderliche Welt um den Protagonisten Truman Burbank eignete. Christof, der Antagonist des Dramas, schafft einen Ort der Kontrolle und minimaler Veränderungen, eine starre Stadt, durch Ansammlung von urbanen und suburbanen Vorteilen für eine gleichförmige Gesellschaft konstruiert (vgl. ebd.: S.93 ff.).
Neue Leipzig-Charta
Zurück im Kontext der heutigen Politik und Stadtentwicklung, wird die „transformative Kraft der Städte“ etwa in der Neuen Leipzig Charta (2020) als Schlüsselfaktor für das Gemeinwohl hervorgehoben. Nur mit einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklungspolitik würden Schritte in Richtung Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität Aller getan werden (ebd., S.7). Auch wird die Ebene des Quartiers als Indikator und Handlungsort für städtische und darüber hinaus für nationale oder globale Problemstellungen betont (ebd., S.12). Durch die engen Verknüpfungen funktional zusammenhängender Räume sind die europäischen Städte auf Austausch und Zusammenarbeit aller Ebenen angewiesen, von größeren Metropolregionen bis zu kleineren städtischen Quartieren. Häufig konzentrieren sich Phänomene wie Wohnungsnot, soziale Spannungen und Umweltbelastungen in den unterschiedlichen Quartieren einer Stadt (ebd., S. 12 ff.).
Insbesondere die polyzentrische Siedlungsstruktur der europäischen Städte und das hohe Identifikationspotential einer historisch gewachsenen Stadt wird als Chance betrachtet, diese weiterzuentwickeln und krisensicher zu gestalten (vgl. ebd., S.30 ff.). Im Rahmen von Quartieren können soziale Innovationen und neue Problemlösungsansätze zuerst umgesetzt werden (ebd., S.12 ff.), beispielsweise in Form eines Fahrradmodellquartiers in der Alten Bremer Neustadt.
Wer macht das Quartier?
Doch wie wird Stadt in Form von Quartieren auf sozialer Ebene produziert? Und von wem genau? Diesen Fragen werde ich in den Blogeintrag “Kreativität und Kultur” mit Bezug auf die Alte Neustadt in Bremen weiter nachgehen…
Literatur
BBSR, Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2020): Die Neue Leipzig-Charta. Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl (Fassung vom 30. November 2020).
Duden.de (2023): Quartier, Cornelsen Verlag, https://www.duden.de/rechtschreibung/Quartier, Zugriff am 25/10/2023.
Feldtkeller, Andreas (2012): Zur Alltagstauglichkeit unserer Städte. Wechselwirkungen zwischen Städtebau und täglichem Handeln. Verlag Hans Schiler, Tübingen/ Berlin.
Kates, Ronald (2000): New Urbanism meets Cinematic Fantasyland: Seaside, “The Truman Show”, and New Utopias. In: Studies in Popular Culture, Oct. 2000, Vol. 23, No. 2, Popular Culture Association in the South.
Läpple, Dieter; Mückenberger, Ulrich; Oßenbrügge, Jürgen (2010): Zeiten und Räume der Stadt: Theorie und Praxis. Verlag Barbara Budrich.
Schnur, Olaf (2021): Quartier und soziale Resilienz. In: Memorandum „Urbane Resilienz“. Wege zur robusten, adaptiven und zukunftsfähigen Stadt. BMI, Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Berlin.
Willinger, Stephan (2012): Stadtquartiere mit Eigenschaften oder: Was ist das, ein gutes Stadtquartier? In: Lebensraum Stadtquartier – Leben im Hier und Jetzt. BBSR, Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung, Stuttgart.